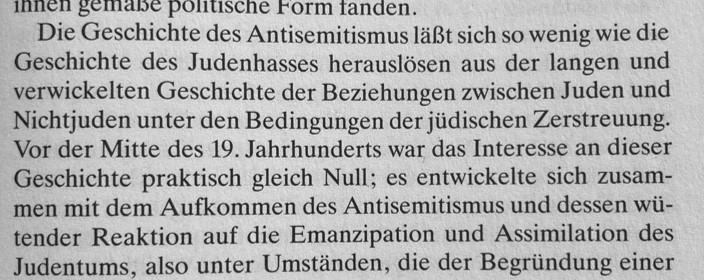Sind doch nur ein paar
1,7 Prozent von 100 Prozent erscheinen auf den ersten Blick nicht viel. Wer kümmert sich schon um 1,7%, schließlich läuft bei 98,3% alles gut. Nur keine Wellen! Nur keine Aufregung! Einer österreichischen Tageszeitung war diese Zahl zumindest eine kleine Schlagzeile wert. 1,7 Prozent der österreichischen Schüler*innen verweigern zurzeit die Testung, die ihnen die Teilnahme am Präsenzunterricht ermöglicht. In der Volksschule stellen sich die Eltern quer, in der Oberstufe die Schüler*innen selbst.
Was all jenen von offizieller Stelle klar kommuniziert wurde: Es besteht in diesem Fall kein Recht auf Betreuung von Seiten der Schule. Es wird auch bei der Benotung am Jahresende nicht die viel zitierte Milde zur Anwendung kommen.
Lehrer*innen und Schulleiter*innen sind angehalten, nicht zu viel nachzufragen. Frei nach dem Motto: Gut, dann kommt das Kind eben nicht, und verliert eben ein Schuljahr.
Warum kein Test?
Warum wollen manche Eltern nicht, dass ihre Kinder getestet werden? Was treibt sie an? Warum nehmen sie nicht die Chance wahr, der Testung des Nachwuchses beizuwohnen?
Ja, es gibt unterschiedliche Gerüchte und Mythen, auf die ich an dieser Stelle gar nicht mehr näher eingehen will. Es ist nicht in meinem Sinn, einen verfahrenen Diskurs neu zu beleben. Ich bin auf der Suche nach Lösungen.
Verhärtete Fronten
Die Fronten sind verhärtet. Zwischen, „na gut dann nicht“ und „mein Kind sicher nicht„, gibt es wenig Platz. Aber wie soll das weitergehen? Denn Test und Masken werden auch im Herbst 2021 Thema sein. „Das Corona Virus ist gekommen, um zu bleiben,“ lautet die realistische Einschätzung der Expert*innen. Was passiert in weiterer Folge mit den Kindern und Jugendlichen, die schon seit Monaten auf dich selbst und/oder auf ihre Eltern angewiesen sind? In Österreich gibt es eine Unterrichtspflicht und keine Schulpflicht. Theoretisch ist es erlaubt die Kinder zuhause zu beschulen. Am Ende des Semesters beziehungsweise des Schuljahres müssen Prüfungen abgelegt werden. Diesen Weg sind Eltern schon vor der Corona-Krise gegangen. Aber handelt es sich hier um die beste Möglichkeit, wenn diese einer Not oder einer trotzigen Haltung gehorcht? Wie viele Chancen haben jene Kinder tatsächlich, wohlbehalten und sicher durch das Schuljahr zu kommen? Wie gut lernt es sich unter Anleitung von Eltern, die kein Vertrauen mehr in das System haben? Welche Lernerfolge sind zu erwarten, wenn auf der anderen Seite Kolleg*innen stehen, denen dieser Umstand egal ist? Die mit den Schultern zucken und meinen „dann werden diese Kinder und Jugendliche eben das Jahr wiederholen müssen“.
Das Gespräch suchen
Ich gestehe an dieser Stelle, dass meine Kommunikationsbereitschaft mit Corona-Leugner*innen sehr schwach ausgeprägt ist. Ich stoße an meine Grenzen. Mir fehlen die Argumente. Aber in diesem Fall geht es nicht um meine Befindlichkeiten, sondern um Kinder und Jugendliche, denen viel mehr als die Vermittlung von Inhalten entgeht. Denn spätestens seit dieser verfluchten Pandemie haben die meisten Menschen begriffen, dass Schule viel mehr ist als ein Ort der ausschließlichen Wissensvermittlung; ein Ort an dem jedes Kind wichtig ist.
Selbst wenn es schwer fällt, die Institution Schule muss das Gespräch suchen. Auch dann, wenn die Lehrer*innen angehalten wurden Diskussionen zu vermeiden. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, hat vor vielen Jahren Erich Kästner geschrieben. Die Zeiten sind außergewöhnlich.
Mögliche Strategien
Zuerst sollten wir, also die Institution Schule, überlegen wie gut wir die betreffenden Eltern kennen. In weiterer Folge lohnt es sich die Perspektive zu wechseln. Viele Eltern sind verunsichert, verstehen vieles immer weniger. Das kann ich nachvollziehen. Wie war das mit K1 und K2. Wann bin ich K1, wann nicht? Ich bin geimpft, trage Maske, hab eine positive Schülerin nur 15 Minuten in der Klasse gehabt. Was ist mit den Klassenkolleg*innen? Sind die K1 oder nur jene, die in der Nähe des Kindes sitzen? Ein Test ist positiv, der andere negativ. Was nun? In diesem „Dschungel“ finden sich nicht nur 1,7 Prozent schwer zurecht. Was? Wie? Warum? Ja oder nein? In all dieser Verunsicherung erklärt dann zum Beispiel ein Nachbar oder eine beste Freundin, dass das alles Quatsch wäre. Dass die Nachbarin jemanden kennt, der kennt auch jemanden und der hat einen entfernten Verwandten, dessen Vater angeblich an Corona verstorben ist, aber dem war gar nicht so. Also, alles Lüge. Es ist der Gesamtsituation geschuldet, dass an den Stellen nach Hilfe gesucht wird, die einfache Lösungen für komplexe Probleme scheinbar aus dem Ärmel schütteln. Das ist und war immer die Masche derjenigen, die verwirrte Menschen für abartigen Theorien begeistern wollen. Es hilft auch nichts in diesen Situationen etwaige Machtgefälle in den Fokus zu rücken. Im Sinne von: Ich bin die Lehrerin. Ich weiß am besten Bescheid. Das werden Sie doch verstehen! Jede Wette, dass die angesprochenen Eltern sofort auf Abwehr gehen, das Kind einpacken und beleidigt das Gespräch abbrechen. Im schlechtesten Fall drohen diese dann mit Anwalt und Behörden.
Hilfe zu holen ist ein Schritt, der vielen Lehrer*innen nicht leicht fällt. Irgendwie haben wir uns daran gewöhnt, dass wir vieles im Alleingang lösen müssen. Im Hinterkopf haben wir, dass es ein Zeichen von Schwäche sein könnte, Kolleg*in XY um Rat zu fragen. Kommt das denn gut, die Kolleg*in zu ersuchen, ein heikles Gespräch zu übernehmen, weil die eigenen Grenzen erreicht sind? Was zur Hölle wird er oder sie denken?
Wäre ich besagte Kollegin, ich würde mich in erster Linie wertgeschätzt fühlen. Mir würde das Vertrauen, das mir in diesem Fall entgegengebracht wird, viel bedeuten. Ich würde auch jene Kollegin bewundern, die klar sagt, ich kann das nicht. Schwächen zuzugeben ist kein Makel.
An den meisten Schulen gibt es Sozialarbeiter*innen und/oder Psychagog*innen. Sie könnte man zu Hilfe holen, weil sie andere Möglichkeiten des Zugangs zu Eltern und Schüler*innen haben. Oberste Prämisse sollte sein, dass jene Eltern und Schüler*innen spüren, sie werden mit all ihren Bedenken und Anliegen ernst genommen. Dass die Institution Schule das Kind, und nicht persönliche Befindlichkeiten, in den Vordergrund stellt. Behutsam, wertschätzend und möglichst frei von Vorwürfen könnte man vermitteln, wie wertvoll die/der Schüler*in für die Klasse ist. Dass Freund*innen ihn oder sie vermissen. Dass man die Eltern, wie schon erwähnt, auch zum Teil versteht. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass all das ernst gemeint ist.
Es gilt verhärtete Fronten aufzuweichen, und nicht einen kaputten Karren weiter an die Wand zu fahren.
Und wenn das alles nicht hilft?
Garantie, dass diese Ideen funktionieren, gibt es keine. Wenn sich Eltern tatsächlich völlig querlegen, dann wird es problematisch. Wie ich persönlich in diesem Fall reagieren würde? Ich würde den Eltern und ihren Kindern nicht jegliche Unterstützung verweigern, nicht alle Türen beleidigt zuschlagen. Selbst wenn alles wild verfahren ist, die Kinder sind die Leidtragenden. Also würde ich diese, im Rahmen meiner Möglichkeiten, unterstützen, solange bis das Kind wieder in die Schule kommen darf oder möchte.
Maria Lodjn ist Lehrerin an einer Mittelschule in Wien.