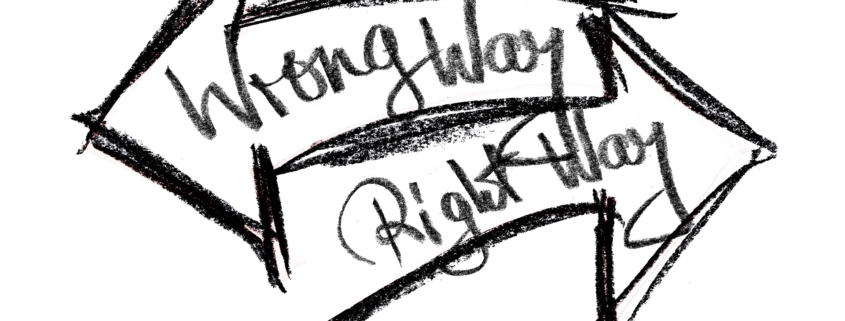Meine Liste mit den Schularbeitsnoten der 4b zirkuliert in der WhatsApp-Gruppe der Schüler*innen. Ich habe sie ihnen weder geschickt, noch habe ich ihnen die Noten schon gesagt. Jemand muss an meine Sachen gegangen sein, die ich in der Pause immer am Tisch liegen lasse. Ich vertraue meinen Schüler*innen, das wissen sie. Jemand muss in Windeseile mein Notenheft geöffnet, das Handy gezückt und ein Foto geschossen haben. Ich bin schockiert, enttäuscht, und richtig wütend…
„Das Lehrerzimmer“
Dieser Vorfall liegt bereits fünf Jahre zurück. Trotzdem kam er mir sofort in den Sinn, als ich kürzlich den Film „Das Lehrerzimmer“ im Kino sah. Im Film können wir eindrücklich beobachten, wie an einer Schule ausgelöst durch Diebstähle zunehmend die Stimmung kippt. Die Suche nach dem Dieb oder der Diebin treibt die Handlung voran: Wer ist schuld?
Im Mittelpunkt steht eine engagierte Lehrerin, die versucht das Richtige zu tun. Das versuchen auch andere, und dabei wird alles nur noch schlimmer. Schnell verbreitetet sich eine ungute Atmosphäre. Misstrauen, Kontrolle, und Angst wachsen – die Anspannung ist im Kinosessel spürbar. Aus Lehrer*innen werden Ermittler*innen, Gespräche zu Verhören, Anschuldigungen gemacht und Beweise gesammelt. Wer war zur falschen Zeit am falschen Ort? Wer könnte ein Motiv haben? Wer verstrickt sich in Widersprüchlichkeiten? Wer hat vielleicht die „falsche“ Herkunft?
Am Ende des Films sind mehr Fragen offen als beantwortet, und die Frage, wer gestohlen hat, sowieso. Einzig klar ist: Die Situation ist komplex.
Auf der Suche nach dem richtigen Handeln
Wer in einer Schule arbeitet, kennt solche Szenarien. Etwas passiert, ob klein oder groß, und sofort beginnt die Suche nach der oder dem Schuldigen. Wer hat in der Pause die Wasserflasche über dem Heft von Ivana verschüttet? Wer hat die Prügelei am Gang begonnen? Wer hat das iPad von David genommen? Wer hat gepetzt? Wer hat das Fenster aufgemacht? Wer hat für Unordnung gesorgt? Und so weiter. Nicht nur von Seiten des schulischen Personals, sondern gerade auch Schüler*innen fordern mit oft großer Vehemenz ein, dass ein Urteil gefällt wird: Wer ist schuld? In einem Moment stehe ich da und halte Pausenaufsicht, im nächsten Moment soll ich Polizistin und Richterin gleichzeitig spielen. Stunden um Stunden, die ich in der Vergangenheit damit zugetragen habe, entsprechende „Ermittlungen“ anzustellen, stets im Bemühen fair und richtig zu handeln.
Mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass es nach vielen Vorfällen eine relevantere Frage als die nach der Schuld gibt: Was brauchst du? Was wünschst du dir? Und zwar an die ganze Gruppe gestellt, nicht nur an Opfer und Täter*in einer konkreten Handlungssituation. Was brauchen wir alle um weitermachen zu können? Um ein Miteinander (wieder) zu ermöglichen? Um das Vertrauen (wieder) herzustellen? Um das Geschehene hinter uns lassen zu können?
Diese Fragen können wir als Lehrer*innen stellen. Das können Schüler*innen als Peer-Mediator*innen machen. Manchmal braucht es dafür auch externe Mediator*innen. Und das schließt nicht aus, dass es auch Konsequenzen („Strafen“) geben kann oder soll. Gerade weil Situationen oft komplex sind, sollten Konsequenzen jedoch Produkt eines anders gestalteten Prozesses sein. Manchmal nimmt das mehr Zeit in Anspruch, viele Male sogar weniger.
Aus Fehlern lernen
Auch vor 5 Jahren wollte ich in erster Linie herausfinden, wer schuld ist, wer es getan hat. Wer war an meinen Sachen, und hat meine Privatsphäre und mein Vertrauen verletzt? Und natürlich habe ich es herausgekriegt. Gerade weil die Basis zu dieser Klasse so stark war, hat meine Welle an Vorwürfen und emotionalem Druck wirkungsvoll eingeschlagen. Ich habe schnell und mit wenig Aufwand herausbekommen, wer es getan hat. Ein Erfolg war es jedoch keiner, wie ich bald erkennen sollte. Es war der Schüler, von dem ich es am wenigsten erwartet hätte. Früher als schlecht in Mathe abgestempelt, ist er in meinem Unterricht aufgeblüht, hat sich angestrengt und beeindruckende Leistungen erbracht. Einige Tage nach der Schularbeit habe ich der Klasse gesagt, dass ich die Ergebnisse schon hätte, sie ihnen aber noch nicht sagen würde. War das aus Unbedachtheit? Eine „Erziehungsmethode“? Praktischen Umständen geschuldet? Ich erinnere mich leider nicht mehr. Aber dieses „Ihr-müsst-noch-warten“ hat mit allen Schüler*innen etwas gemacht, und den Schüler, dem seine Mathematik-Leistungen so wichtig geworden waren, hat es unter großen Stress und psychischen Druck gesetzt. Er konnte nicht länger warten, keine weiteren Minuten oder gar Stunden mit Grübeln und Sorgen verbringen, er wollte unbedingt sein Ergebnis wissen, wo es doch so verlockend am Tisch vor ihm lag. Und er wollte den anderen auch zur Erleichterung und Klarheit verhelfen. Damals war die Sache für mich abgehakt, nachdem ich wusste, wer es getan hat und wer Konsequenzen bekommen würde. Heute frage ich mich, wie sich die Beziehung zwischen mir und meinen Schüler*innen weiterentwickelt hätte, hätte ich all diese anderen Fragen gestellt.
Wenn ich statt „Wer ist schuld?“ gefragt hätte „Was brauchen wir?“.
Die Autorin ist Lehrerin an einer Mittelschule in Wien.